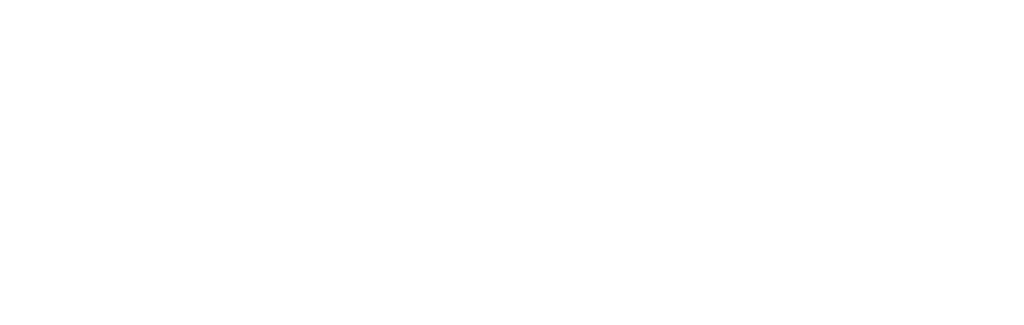Von Anna Müller (Text, Fotos & Videos), Konstantin Klenke (Daten) und Carla Moritz (Fotos)
Lesedauer: ca. 7 Min.
Es quiekt. Es ist wuselig. Fütterungszeit. Ferkel purzeln übereinander. Das Gedränge um die Futterrinne ist so groß, dass man kaum sehen kann, wie das flüssige Futter aus Mais, Raps und Soja aus dem Silo über schmale Metallröhren in die Rinne hineinläuft.
Mittendrin steht Junglandwirt Christoph Fröhle – in schwarzen Gummistiefeln und einem dunkelgrünen Overall. Wenn die Ferkel fertig gefressen haben, füllt er etwas Trockenfutter aus Hafer in zwei gelbe Behälter, um die Ferkel zu beschäftigen. Sie stupsen mit dem rosa Rüssel einen Metallhebel an. Dann bröselt das trockene Pulver auf den nackten Boden.
Am Rand der Stallbox baumeln an einer Metallstange staubige Kunststoffbälle und Sterne – der große angeknabberte Stern ist offenbar das beliebteste Spielzeug. Die Luft ist stickig – ein intensiver, stechender Geruch liegt über allem. Ferkel sind süß, aber sie stinken. Ihre Ausdünstungen, Gülle und Mist belasten das Klima.
Die Landwirtschaft erzeugt vielfältige Treibhausgasemissionen, unter anderem durch die Verdauung der Tiere. Insgesamt verursachte die deutsche Landwirtschaft laut Zahlen des Thünen-Instituts im Jahr 2023 rund 54,8 Millionen Tonnen Kohlendioxid-Äquivalente.
Auch die Sauen und Ferkel von Christoph Fröhle belasten die Umwelt – unter anderem als Emittenten des Luftschadstoffs Ammoniak. Laut Zahlen des Umweltbundesamts ist Landwirtschaft mit einem Anteil von 95 Prozent in Deutschland Hauptemittent von Ammoniak. Gemäß der Emissionsberichterstattung stammen davon über 70 Prozent aus der Tierhaltung. Im Vergleich fällt der Anteil der Schweinehaltung (19 Prozent) daran deutlich geringer aus als der Anteil der Rinderhaltung (43 Prozent).
Fröhle ist offen für Veränderung
Der 36-jährige Fröhle lebt mit seiner Frau Katharina und dem zweijährigen Sohn Jakob auf dem Hof in Lastrup im Landkreis Cloppenburg. Im Nachbarhaus wohnen seine Eltern. Von seinem Vater hat er vor 15 Jahren den Hof übernommen. Nach der Schule wusste er nicht, was er machen möchte, und sei so in die Landwirtschaft „reingerutscht“.
Seitdem versucht er immer wieder seinen konventionellen Betrieb zu optimieren: Durch Anpassung des Futters, Zwischenfruchtanbau auf dem Feld und Photovoltaikanlagen auf dem Dach. Fröhle nimmt den Klimawandel ernst – wie viele Landwirte. Doch in der öffentlichen Wahrnehmung dominiert oft ein anderes Bild.
Klimaschutzmaßnahmen sorgen bei Landwirten auch für Frust, der bei den Bauernprotesten 2023 und 2024 in der Öffentlichkeit lautstark geäußert wurde. Besonders präsent war laut Pascal Leddin, Abgeordneter von den Grünen im Niedersächsischen Landtag, der Streit um Agrardieselsubventionen. Sie waren der Auslöser für die Proteste, seien aber eben als klimaschädliche Subventionen einzuordnen. „Trotzdem sagen die Landwirte natürlich, dass sie die Subventionen weiterhin brauchen“, sagt Leddin.
Grünen-Politiker: Landwirte sind als Betroffene nicht gegen Klimaschutz
Das Vorurteil, Landwirte seien Klimaschutzgegner, hält Leddin aber für falsch. Im Gegenteil: Er sieht Landwirte als Treiber von Klimaschutz. „Denn es ist ja auch im Interesse der Landwirtschaft Klimaschutz zu betreiben“, so Leddin.
Denn die Landwirtschaft ist auch betroffen vom Klimawandel. Heißere und häufigere warme Sommertage heizen die Ställe auf. Dadurch verschlechtern sich die Haltungsbedingungen für die Tiere erheblich.
Auf Feldern ist unter anderem die Trockenheit das Problem – auch auf einem Feld von Fröhle am Rand der Ferkelställe, auf das die Sonne am Mittag knallt. Zwischen grünen Sträuchern blitzen lila Blüten im Sonnenlicht hervor, doch der Boden staubt bei jedem Schritt übers Feld. „Im Mai, als es so heiß war, habe ich auf dem Boden ohne alles 50 Grad gemessen“, erzählt er, während er zwischen den Sträuchern und Blumen hockt und die abgeschnittenen Gerstenstoppel betrachtet. „Da wo der Boden mit Stroh bedeckt war, waren es nur 29 Grad – das ist ein großer Unterschied.“

„Grüne Mütze“ gegen die Sonne
Die lila Blüten sind Teil einer sogenannten Zwischenfrucht, meist eine Mischung aus fünf verschiedenen Kulturen, die Fröhle auf dem Feld anbaut. Die Zwischenfrucht vergeht im Winter bei etwa minus ein Grad.
Sie hinterlässt Biomasse und somit Nährstoffe, die dann wiederum der Mais als Hauptfrucht im Frühjahr aufnehmen kann. Durch Durchwurzelung des Bodens kann der Mais im Frühjahr außerdem besser wurzeln. Zudem kann der Boden durch die Zwischenfrucht den Regen aufnehmen und das Wasser fließt nicht ab. Die Pflanzen schützen den der Acker vor Sonne: „Wir als Mensch können uns eine Mütze aufziehen, der Boden kann das nicht“, sagt Fröhle.
Damit ist die Zwischenfrucht auch eine Maßnahme, um den Boden bestmöglich zu wappnen angesichts häufiger werdender Extremwetter durch den Klimawandel. Fröhle ist überzeugt: „Wir brauchen mehr Kulturen- und Anbauvielfalt.“ Der Zwischenfruchtanbau tut langfristig dem Boden und damit auch dem Klima gut.
Umdenken in der Landwirtschaft
Jonas Böhm ist Agrarökonom und forscht beim Thünen-Institut zu Agrartechnologie. Er sieht einen Unterschied zwischen den Generationen, da viele ältere Landwirte eher konventionell eingestellt seien. Sein Eindruck: „Sie wollen keine Änderungen und wollen so wirtschaften wie sie schon immer gewirtschaftet haben. Man sieht eher ein dynamischeres Potenzial bei den Junglandwirten, die Innovation und Änderung reinbringen in bestehende Systeme.“
Auch die Politik entwickelt Pläne für eine Landwirtschaft der Zukunft. Böhm verweist auf die extra eingerichtete Zukunftskommission Landwirtschaft des Bundes, die als eines von vielen möglichen Zielen Nutztierbestände reduzieren will.
Dieser Plan sei für einzelne Betriebe, deren Haupterträge darauf aufbauen, sehr schwierig umzusetzen, gibt er zu Bedenken. Er sagt, genau an dieser Stelle müsste die Politik den Wandel dann auch unterstützen. Fröhle hält von einer drastischen Reduzierung nichts. Für ihn stehe die Entwicklung der Tierbestände im Zusammenhang mit Angebot und Nachfrage.
Im Stall der Sauen überprüft Fröhle die Futtertröge auf seinem täglichen Kontrollgang: Haben die Tiere genug Wasser? Wie ist die Luft? Links und rechts eines schmalen Ganges warten auch die Sauen in ihren Boxen darauf gefüttert zu werden. Anders als bei den Ferkeln ist alles etwas ruhiger und die Sauen stehen beim Fressen in einer Reihe nebeneinander. In die Rinne fließt eine braune Getreidesuppe – ein optimiertes Futtergemisch.
Klimaschutz im Stall
Während im Lehrheft von seinem Vater noch „viel hilft viel“, stand, nutzt Fröhle mittlerweile das sogenannte stark NP-reduzierte Futter. Das heißt, dass der Gehalt von Stickstoff (N) und Phosphor (P) gezielt reduziert wird, um Emissionen einzusparen.
Durch Erneuerung des Dachs vor zwei Jahren sind die Ställe zudem gut isoliert und Fröhle kann Energie einsparen, da er im Sommer weniger ventilieren und im Winter weniger heizen muss. Zudem habe er mittlerweile durch Auflagen im Tierwohl eine geringere Belegung – weniger Tiere gleich weniger Emissionen.
Um seine Tiere gut versorgen zu können, braucht Fröhle aber trotzdem viel Energie: im Stall für die automatisierte Fütterung, die über eine Pumpe läuft, für die Ventilatoren, die den Stall lüften sowie für Licht und Reinigung. Für günstigeren Strom hat er auf den Dächern seiner Ställe neun unterschiedliche Solaranlagen verbauen lassen. Die erste hat noch sein Vater 2004 beauftragt, die neueste kam in diesem Jahr dazu. Eigener Strom sei im Winter in jedem Fall günstiger, außerdem motiviert ihn auch „das gute Gewissen, dass der Strom auf jeden Fall nachhaltig ist“, so Fröhle.
Auf seinem Handy kann er seine Solaranlagen jederzeit kontrollieren. Ein Graph in der App zeigt ihm an, dass der Speicher bis 20 Uhr gefüllt war und sich dann in der Nacht langsam geleert hat. Mit den ersten Sonnenstrahlen ab 8 Uhr füllt sich der Speicher wieder Schritt für Schritt.
Nutzungskonflikte durch Freiflächenanlagen
Solaranlagen gibt es nicht nur für Dächer, sondern auch auf der freien Fläche. Fröhle hat jedoch keine der sogenannten Photovoltaik-Freiflächenanlagen und möchte diese auch nicht in Zukunft verbauen. Für ihn sind sie Flächenverschwendung. Auf der Fläche, die er hat, möchte er Landwirtschaft betreiben.
Doch es gibt auch Landwirte, die bereits in Freiflächenanlagen investiert haben. Dabei spielt die Größe des Betriebs eine entscheidende Rolle, so Böhm. „Wir haben in Bayern durchschnittliche Betriebsgrößen von etwa 50 Hektar pro Betrieb. In den in neuen deutschen Bundesländern sind es eher 500 bis 1000 Hektar pro Betrieb“. Während eine 50 Hektar große Freiflächenanlage somit für den größeren Betrieb eine Möglichkeit zur Diversifizierung der Investitionsstrategien darstellt, heißt es für kleine Betriebe, dass sie ihre Flächen dann gar nicht mehr landwirtschaftlich nutzen könnten.
Aktuell stehen auf etwa 0,2 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzflächen in Deutschland Freiflächen-Solaranlagen, so Jonas Böhm vom Thünen-Institut. Wenn man das aktuelle Ziel des Ausbaus erneuerbarer Energien im Erneuerbare-Energien-Gesetz berücksichtigt, dann müssten Böhms Berechnungen zur Folge zukünftig etwa 1-2 Prozent mit Freiflächen-Solaranalagen bebaut werden. Das heißt verhältnismäßig werde wenig Fläche gebraucht, vergleiche man es beispielsweise mit Biogasanlagen (9-10 Prozent).
Weil die landwirtschaftlichen Flächen jedoch zu 60 Prozent verpachtet werden, kann es regional trotzdem zu größeren Nutzungskonflikten kommen. Insbesondere wenn mehrere Anlagen in derselben Region errichtet werden, ist das der Fall, da diese dann die nächsten 20 Jahre nicht für die intensive landwirtschaftliche Nutzung zur Verfügung stehen.
Die Investition in Photovoltaik auf dem Dach lohnt sich
Die Photovoltaikanlagen auf dem Dach hingegen seien in erster Linie eine unternehmerische Entscheidung gewesen, gibt Fröhle zu, da sie finanziell attraktiv waren. „Der Aufwand ist gering, weil es ein einfaches Geschäftsfeld ist, bei dem ich nur kontrollieren muss“, sagt Fröhle, „und es nutzt eine vorhandene Ressource: das Dach.“
Darüber hinaus sorgt die Photovoltaikanlage für eine gewisse Energieautarkie: Rund 60 Prozent des Stromverbrauchs auf dem Hof und im Privathaushalt kann er mit eigenem Strom aus den Solaranlagen decken.
Es ist früher Nachmittag und Fröhle muss noch einmal mit dem Traktor aufs Feld rausfahren. Hinter dem Traktor bohren sich große Metallzinken tief in den kahlen Acker. Im Unterschied zum Pflug wendet der sogenannte Tiefenlockerer den Boden nicht, sondern bricht ihn tief auf. Das ist schonender für den Boden. Und für das Klima. „Jede Bodenbearbeitung setzt CO2 frei“, erklärt Fröhle. Mit Pflugmaschienen arbeitet er bewusst schon seit einigen Jahren nicht mehr.
Fröhle ist offen für Innovationen. Er hat begonnen Schritt für Schritt etwas zu verändern, immer im Blick: die Zukunft seines Hofes, seiner Familie. Und – wenn auch oft unterbewusst – das Klima.
Informationen zur Datenerhebung und -analyse
Emissionen aus Landnutzung, Landnutzungsänderung und Forstwirtschaft (LULUCF) sind nicht Teil der hier genutzten Klima-Daten. Der Grund: Diese Werte sind schwer genau zu messen und würden das Risiko von Doppelzählungen erhöhen. Sie daher nicht zu berücksichtigen, ist international gängig.
Die Emissionszahlen stammen vom Umweltbundesamt und orientieren sich an den UN-Vorgaben. Dort werden Emissionen teilweise anderen Sektoren zugeordnet als im deutschen Klimaschutzgesetz. Beispiel: Abgase von Traktoren, Heizungen in Ställen und andere energiebedingte Emissionen aus der Landwirtschaft zählen international zum Energiesektor, in Deutschland aber zum Landwirtschaftssektor. 2023 machte dieser Unterschied laut Umweltbundesamt 8,2 Millionen Tonnen CO₂-Äquivalente aus. Für das grafisch dargestellte Klimaziel 2030 wurde deshalb der Wert des deutschen Landwirtschaftsziels (56 Mio. Tonnen) um diese 8,2 Mio. Tonnen reduziert. Das prozentuale Ergebnis entspricht in beiden Fällen etwa 65 % der Emissionen von 1990.
Die Befragungsdaten zur Klimawahrnehmung stammen aus dem European Social Survey (Welle 11). Zur Gruppe „Landwirtinnen und Landwirte“ zählen Befragte aus den NACE-Gruppen zur Pflanzen- und Tierproduktion sowie verwandten Bereichen, aber nicht Selbstversorgerinnen oder Hilfskräfte. Grundlage war die Berufsklassifikation ISCO08 (Codes 1311, 6100, 6111, 6114, 6120, 6121, 6122, 6129, 6130). Damit die Ergebnisse repräsentativ sind und die Größenunterschiede der Länder und Besonderheiten der Befragung abbilden, wurden die Antworten gewichtet (Poststratifizierung und Designgewicht). Befragt wurden 785 Landwirtinnen und Landwirte und 45.376 Personen aus anderen Berufen.