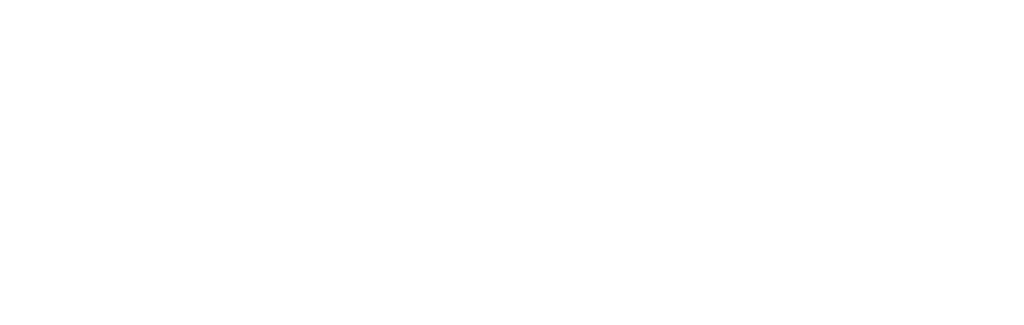Von Christopher Müller (Text) und Clara Müller (Fotos & Videos)
Lesedauer: ca. 6 Min.
4:30 Uhr, alle Menschen schlafen, nur Silke Poesthorst steht wie jeden Tag schon im Schlafanzug in ihrer Käserei. Hier macht die 48-jährige Landwirtin aus der Schafsmilch vom Vortag Käse. Draußen, auf dem Dahlhorster Hof dämmert es. Innen, in dem gelben, kleinen Container arbeitet Silke oft bei rund 28 Grad und „gefühlten“ 90% Luftfeuchtigkeit. „Im Sommer ist es ’ne Sauna hier drin. Das ist dann anstrengend.“

Laut der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt sind Obst- und Gemüsebau, aber auch die Tierhaltung, körperlich besonders anstrengend. Silke hat rund 50 Lämmer und 35 Schafe. Sie leitet ihren eigenen Ein-Frau-Betrieb. Trotzdem: die Arbeit auf dem Hof geht ihr leicht von der Hand. „Wir sind nicht repräsentativ. Wir sind ja ein kleiner Pups-Betrieb und werden von allen belächelt. Das ist auch okay. Das hier ist so ein Bilderbuchding und ich weiß das aber auch zu schätzen“, sagt die Landwirtin stolz.
Anstrengung ist Ansichtssache
Um 6 Uhr beginnt auch für die Tiere die Arbeit. Dann stehen rund zehn schwarze und weiße Schafe nebeneinander auf dem selbstgebauten Melkwagen. Einem überdachten Anhänger, an den Silke und ihr Vater zwei Holzrampen und ein Fressgitter gebaut haben. Das Gitter hält die Schafe an Ort und Stelle und durch das Futter sind sie abgelenkt. „Melken ist das schönste am Tag“, sagt Silke, während sie sich über das Holzgeländer auf eine kleine Leiter schwingt. „Das hält fit“, kommentiert sie und schließt die Melkmaschine an die Euter an. Es summt. Milch spritzt im Takt abwechselnd aus zwei Schläuchen in eine durchsichtige Kanne. Für Silke ist das Routine: „Da ist gar nix anstrengend, das ist einfach Melken.“ Normalerweise hört sie dabei Podcasts wie Gemischtes Hack oder Kaulitz Hills. „Ich melk‘ dann so vor mich hin und hab den Kopf frei zum Nachdenken.“
Nach getaner Arbeit trotten die ersten Schafe zurück in den Stall. Silke klettert wieder auf den Wagen. Mit der linken Hand zieht sie an einem Seil, um die Luke zu öffnen und die nächsten Schafe auf den Wagen zu lassen. Gleichzeitig schiebt sie mit der rechten Hand die ersten Schafe in das Futtergitter. Um Multitasking kommt man auf seinem eigenen Hof nicht herum. „Man muss ständig etwas flicken und reparieren. Früher hat das mein Papa gemacht. Letztes Jahr ist er gestorben, jetzt muss ich mich auch noch mit dem Kleinkram rumschlagen“, erklärt die Landwirtin. „Die Leute denken immer, ein kleiner Hof bedeutet wenig Arbeit. Es ist aber das Gegenteil.“
Kleinen Höfen fehlt oft das Geld, um in moderne Technik zu investieren. Viel wird daher noch von Hand gemacht, zum Beispiel das Reinigen der Eimer-Melk-Anlage. Eine moderne Melkanlage könnte das von selbst. Neue Technik bringt aber auch neue Herausforderungen mit sich. Karen Sommer von Agrotech Valley, einem Netzwerk für digitale Agrartechnologien, weiß: „Ein Landwirt, der auf einen Melkroboter setzt, muss vielleicht nicht mehr morgens um vier Uhr zum Melken aufstehen. Aber er wird auch zum Datenmanager, denn er muss die Daten, die die neue Technik ausspuckt, auch lesen und interpretieren können.“
Arbeit, die Spuren hinterlässt
Auf dem Dahlhorster Hof füllen sich die Milchkannen. Nach gut eineinhalb Stunden und 35 gemolkenen Schafen sind zwei große Kannen mit rund 40 Liter Schafsmilch gefüllt. So viel produziert eine mittelgute Milchkuh allein am Tag. Mit festem Griff, steifen Armen und einer 20-Kilo-Kanne in jeder Hand, schleppt Silke die Milch über den Hof. Erst zur Käserei, dann zum Kühlhaus. Was anstrengend wirkt, ist für sie Routine.
Dennoch hinterlässt die Arbeit Spuren. Laut der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau zählten im vergangen Jahr Hautkrankheiten und Lärmschwerhörigkeit zu den häufigsten Berufskrankheiten in der Landwirtschaft. Viele Landwirte klagten auch über Rückenschmerzen. Auch Silke hatte damit mal Probleme, gerade aber nicht. „Es gibt bei mir eine Winter-Fitness und eine Sommer-Fitness. Im Sommer hält mich die Anstrengung auch fit. Am Anfang der Saison muss man halt erst wieder reinkommen und im Winter muss ich dann sowas wie Sport machen“, sagt sie.
„Es ist immer Arbeit.“
Silke hat immer noch alle Hände voll zu tun. „So, jetzt kühlt die Milch gerade ab, jetzt kann ich kurz den Stall ausmisten“, sagt sie, als sie aus der Käserei und vor das alte Fachwerkhaus tritt. Jede Pause wird zur nächsten Aufgabe. So wie bei vielen Selbstständigen. „Es ist immer Arbeit. Man muss lernen, zu priorisieren und sich selbst zu sagen: ‚Die Pflaumen muss ich jetzt nicht auch noch pflücken.‘ Viel wird dann auch auf den Winter geschoben“, erklärt die 48-Jährige.
Mit dieser Erkenntnis hat sie vielen Landwirten etwas voraus. Anne Dirksen von der Landwirtschaftskammer Niedersachsen weiß: „Die Selbstfürsorge ist eine unternehmerische Aufgabe, oft kümmern sich Landwirte aber nicht darum.“ Sie leitet das landwirtschaftliche Sorgentelefon Niedersachsen und berät Landwirte bei mentalen Problemen. „Viele haben auch das Gefühl ‚ich mach zu wenig im Büro‘ und haben Angst vor Kontrollen“, sagt die 64-Jährige. Silke Poesthorst kennt das: „Selbst für Subventionen muss man dreifach drucken, scannen und es wird einem immer unterstellt, dass man bescheißen will.“
Leben und Arbeit auf dem Hof
Das Besondere bei Silke: Sie schmeißt den Hof die meiste Zeit alleine. Am Wochenende unterstützt ihr Mann sie bei der Arbeit. Die gelbe Sonnenliege vor dem Fachwerkhaus nutzt nur ihre Tochter. Silke hat dafür keine Zeit. „Man lebt und arbeitet eben auf dem Hof. Urlaub auf dem Hof geht nicht. Das hat aber auch Vorteile: kaum sehe ich den Hof nicht, bin ich im Urlaub“, sagt die Landwirtin.

Urlaub geht für sie sowieso nur im Winter und krank werden dürfe sie einfach nicht. Nur letzten Sommer hatte sie, wie sie sagt, „aus Versehen“ eine Mittelohrentzündung. „Das ist wie in der Selbstständigkeit. Wenn man krank ist, muss man trotzdem arbeiten. Ich darf halt nicht krank werden, werde ich auch nicht“, sagt Silke, klopft dreimal auf einen Holztisch vor dem Haus und schnappt sich eine Schubkarre mit einem Wasserbeutel, den sie zu einer Wiese neben dem Hof schiebt.
„Letztes Jahr war ein hartes Jahr.“
Laut ihrer Gesundheits-App ist sie im letzten Halbjahr im Durchschnitt 9.500 Schritte am Tag gelaufen. An der Wiese angekommen, steht Silke kurze Zeit später am Zaun und schaut ihren Schafen dabei zu, wie sie aus dem Stall in die Morgensonne auf die Wiese galoppieren. „Ist das nicht schön? Dafür macht man das alles“, sagt die Landwirtin und lächelt. Die Arbeit mit den Tieren ist für Silke etwas ganz Besonderes und ein Grund, warum sie Landwirtin geworden ist. „Als Kind hab‘ ich immer mit den Kühen vom Nachbarn rumgehangen“, erinnert sie sich.
Die Arbeit mit den Tieren kann aber auch belastend sein. So wie im vergangenen Jahr, als sie 17 Lämmer wegen der Blauzungenkrankheit verloren hat. „Das war schon mental belastend. Ich bin ja eigentlich ein positiver Mensch, aber wenn du auf die Wiese gehst und da liegt immer wieder ein totes Tier, das geht an die Substanz, weil du einfach machtlos bist. Du bist abhängig von Dingen, die du nicht beeinflussen kannst.“
Wertschätzung für die Landwirtschaft
Auf dem Rückweg zum Hof pflückt Silke eine Pflaume vom Baum und freut sich über ihre kleine Ernte. Dann geht es für sie wieder kurz in die Käserei. Diesmal wird der Käse geschnitten und etwas später von Hand gewendet. Zu diesem Zeitpunkt ist auch erkennbar, was aus der ursprünglichen Milchmasse werden soll. Silke produziert heute Käsetaler mit Kapuzinerkresse, die sie dann im eigenen Hofladen oder auf Märkten verkauft. Reich wird sie damit nicht. „Ich allein könnte davon leben, weil ich keinen Luxus brauche und mir der Hof gehört, aber das Studium von meinem Kind könnte ich ohne meinen Mann nicht finanzieren“, erklärt die Landwirtin.
Sie sitzt auf einer alten Holzbank vor dem Fachwerkhaus und trinkt einen Schluck Kaffee. Ab und zu halten hier auch Radfahrer und sprechen Silke an. „Die fragen mich dann manchmal, was ich denn sonst noch so arbeite oder ob ich davon leben kann. Das hasse ich“, sagt Silke und ergänzt: „Die denken, ich hüpfe im Kleidchen über den Hof, freu‘ mich, streichle Tiere und hab‘ dann geilen Käse. Ich bin doch keine Tradwife.“ Die Wertschätzung, die Silke in solchen Momenten fehlt, bekommt sie auf Märkten von ihren Kunden. „Wertschätzung ist ein Riesenthema“, sagt auch Anne Dirksen vom landwirtschaftlichen Sorgentelefon: „Weil der Beruf so in der Öffentlichkeit steht und jeder eine Meinung dazu hat.“
Zwischen Zweifel und Erfüllung
Auch wenn andere Menschen Silke Wertschätzung geben, versucht sie selbst auf sich zu achten. „Natürlich sind eine Therapie oder MeTime Themen für mich, aber wann und wo soll ich das machen? Man kann nicht jeden Tag an das ‚Was wäre, wenn‘ denken, das muss man verdrängen. Dann nehme ich mir halt mal eher Zeit für ein Eis, telefoniere mit Freunden, höre Podcasts oder gehe früher schlafen“, sagt Silke. Landwirte, die im Gegensatz zu Silke nicht wissen, wie sie mit der mentalen Belastung umgehen sollen, berät Anne Dirksen. „Es ist schon so, dass es alle Altersgruppen, Geschlechter, Betriebsformen und Gehaltsklassen betrifft. Zuletzt waren vor allem viele junge Menschen betroffen und die Wartezeiten vom Sorgentelefon werden immer länger“, warnt sie.
„Ich zweifle auch ständig. Es ist immer der beste und schlimmste Beruf der Welt. Manchmal denke ich: ‚ich verpachte den ganzen Scheiß hier und verdiene einfach dasselbe Geld‘“, sagt Silke Poesthorst und schiebt dann hinterher: „Es ist ein unglaublich schöner Beruf. Die Arbeit mit den Tieren, mit Milch ist einfach erfüllend. Man ist draußen und kann Sachen herstellen, die anderen schmecken.“ Dann nimmt sie einen Schluck von ihrem Kaffee mit Schafsmilch und lächelt.