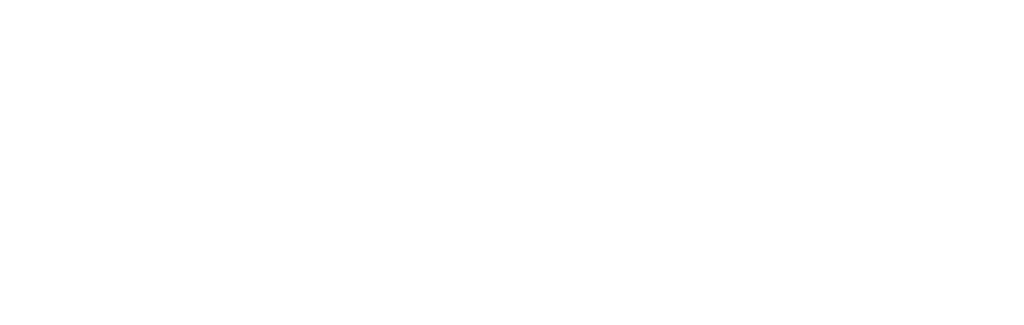Von Lilly Timme (Text & Fotos), Valentin Heib (Fotos) und Mailin Matthies (Daten)
Lesedauer: ca. 7 Min.
Nummer 834 liegt ruhig im Stroh. Nur seine Ohren zucken leicht in Richtung der Geräusche im Stall. Ein gutes Zeichen, sagt Landwirt Ulrich Westrup, denn das sogenannte Ohrenspiel zeigt, dass das Kalb aufmerksam auf seine Umwelt reagiert. „Einem kranken Kalb ist alles egal, da hängen die Ohren schlapp herunter.“ Am rechten Ohr trägt Kalb Nummer 834 einen orangenen Clip. Darin befindet sich ein Sensor, über den Landwirt Westrup und sein Team jeden Schritt, jede Ruhephase und jedes Wiederkauen in Echtzeit messen können. Ist etwas auffällig, bekommen sie eine Push-Benachrichtigung aufs Handy.
Kalb 834 gehört zum neuesten Nachwuchs auf Westrups Hof. 600 Milchkühe in Stallhaltung. Das Hofgelände ist so groß, dass der Landwirt den Weg vom Stall zum Büro auf dem Fahrrad zurücklegt. Betriebe wie seiner stehen für ihre Form der Tierhaltung immer wieder in der Kritik. Der Vorwurf: Landwirte, die konventionelle Tierhaltung betreiben, stellen wirtschaftlichen Profit über das Tierwohl. Ulrich Westrup sieht das anders. Für ihn ist die Wirtschaftlichkeit seines Betriebes untrennbar mit dem Wohl seiner Kühe verbunden. „Nur wenn es den Tieren gut geht, geht es auch uns gut“, sagt er.
Daten sammeln und reagieren
Das Sammeln und Überwachen von Daten spielt dabei eine wichtige Rolle. Denn anhand dieser Daten kann Westrup in Echtzeit das Wohlbefinden seiner 600 Tiere feststellen und frühzeitig Probleme bemerken und gegensteuern. Einmal im Monat holt er sich zusätzliche Unterstützung von Tierärztin Hanna Strodthoff-Schneider.

Hanna Strodthoff-Schneider und Ulrich Westrup bei der Futterkontrolle.
Heute kontrolliert die Tierärztin nach dem Futterlager und dem Kälberstall die hochträchtigen Kühe. „Hier gab es beim letzten Mal einige Euterentzündungen“, sagt sie. „Die Einstreu in den Boxen war wohl ein bisschen zu feucht.“ In grünem Overall und Gummistiefeln hebt sie die Absperrung zum Stall an. Ihr folgt Greta Mandrella – sie ist Herdenmanagerin und betreut die Kühe täglich. Beim Blick in die Boxen nickt Strodthoff-Schneider. Der Betrieb hat ihre Anmerkung vom letzten Besuch beachtet – die sandfarbene Einstreu ist trocken. Die meisten Kühe liegen in ihren Boxen und mahlen leicht mit dem Kiefer. „Da sieht man, dass sie zufrieden sind“, sagt Strodthoff-Schneider, „wenn eine Kuh gestresst ist, dann kaut sie nicht wieder“. Dass die Kühe die Herdenmanagerin und die Tierärztin kaum beachten, wertet sie ebenfalls als gutes Zeichen. „Man sollte die Bedürfnisse der Kühe eben auch nicht vermenschlichen“, sagt Strodthoff-Schneider. „Eine Kuh liebt es absolute Langeweile zu haben, dass jeden Tag die gleiche Person füttert, zur gleichen Zeit gefüttert wird, sie am besten noch in ihrer eigenen Liegebox liegt. Die wollen einfach jeden Tag die gleichen Routinen, dann sind sie am glücklichsten.“
Nach der Stallkontrolle mit Tierärztin Strodthof-Schneider zieht sich Herdenmanagerin Greta Mandrella die Gummistiefel aus und es kommen grüne Socken mit Kuhköpfen zum Vorschein. Sie wechselt zurück in ihre Alltagsschuhe und macht sich auf den Weg über den Hof ins Büro, wo gleich die Daten des letzten Monats ausgewertet werden. Datenmonitoring und Computerprogramme seien für sie eine große Unterstützung, aber den direkten „Kuhkontakt“, wie sie es nennt, findet sie weiterhin wichtig. „Das sind schließlich unsere Arbeitskollegen.“
Ansprüche an die Haltung sind gestiegen
Im Büro angekommen gießt Ulrich Westrup allen Mitarbeitern heißen Kaffee in bunte Tassen, jede einzelne mit Kuhmotiv. Dann geht Tierärztin Strodthof-Schneider am Computerbildschirm Tabellen mit den Daten der vergangenen vier Wochen durch. Westrup hört aufmerksam zu. Was messbar ist, will er messen – auch deshalb lässt er seinen Betrieb alle vier Wochen von der Tierärztin kontrollieren. Gibt es eine Auffälligkeit, fragt sie nach, ob das Team eine Erklärung hat. Davon gibt es an diesem Tag aber wenige.
Insgesamt hätten sich das Wissen und die Möglichkeiten in der Prävention und Behandlung von Krankheiten bei Milchkühen in den letzten Jahren so weiterentwickelt, dass der Anspruch an das Wohl der Tiere merklich gestiegen sei, sagt die Tierärztin. Für Landwirt Westrup bedeuten solche Möglichkeiten auch, dass er seltener Antibiotika verabreichen muss und er vermeiden kann, dass Tiere wegen Krankheiten oder Entzündungen weniger oder keine Milch geben. Für die Gesundheit der Tiere ist das gut und für den Landwirt ist es „Produktivität, die sich im Endeffekt auch bei mir im Portemonnaie zeigt“ – nicht zuletzt, weil eine gesunde Kuh bis zu vierzehntausend Liter Milch im Jahr gibt. „Das können die nicht, wenn es ihnen nicht gut geht. Neuntausend Liter. Das kann ich auch unter schlechten Bedingungen machen. Zehntausend vielleicht auch noch. Aber wenn ich darüber hinaus möchte, dann wird es irgendwann schwierig“, sagt Westrup. Deshalb geht er über die Mindeststandards für das Tierwohl hinaus. „Aus purem Eigeninteresse.“
Westrups Hof hält sich an die Tierwohlstandards der Haltungsstufe drei – die zweithöchste Haltungsstufe in der konventionellen Tierhaltung. Bedeutet: seine Tiere haben vergleichsweise viel Platz und Beschäftigungsmöglichkeiten und können frei im Stall herumlaufen. Darüber kommt nur noch die Haltungsstufe vier, bei der Rinder Weidezugang haben müssen – also Auslauf im Freien.
Einer, der die Standards der Haltungsstufe vier erfüllt, ist Landwirt Franz Thole. Auf der Weide wenige hundert Meter von seinem Haus in Lohne betreibt der 36-Jährige eine konventionelle Rindermast in extensiver Haltung. Das ist das Gegenteil von Intensivtierhaltung, also viele Tiere auf wenig Raum. Nur 40 Rinder hält Thole auf seinen 20 Hektar Weide. Zum Vergleich: Die gesetzliche Mindestvorgabe für die Rindermast in der Gewichtsklasse von Tholes Rindern sieht in Niedersachsen drei Quadratmeter pro Rind vor. Bei Franz Thole kommen auf jedes Rind 5000 Quadratmeter Fläche. Wie lohnt sich das für den Landwirt?
Qualität über Quantität
„Es gibt Betriebe hier, die haben 150 Bullen und mehr. Dafür habe ich nicht das eigene Land“, sagt der Landwirt, dessen Familie seit Generationen im Nebenerwerb den Hof betreibt. Dazu kommt, dass viele Subventionen für die Landwirtschaft in Deutschland flächengebunden sind. „Die großen Höfe haben viel Fläche, kriegen viel Subventionen. Unsereins hat meistens weniger Fläche und kriegt dadurch natürlich auch wesentlich weniger Subventionen“, sagt Thole. Deshalb hat sich der Landwirt ein Konzept überlegt, das gar nicht erst versucht, mit den großen konventionellen Rindermastbetrieben zu konkurrieren und das nicht abhängig ist von Subventionen.
Vom Gatter aus sieht man Tholes Rinder nur als kleine Punkte in der Ferne. Als der Landwirt an diesem sonnigen Nachmittag die Weide betritt, kommen sie angerannt. Die Rinder folgen Thole, versuchen an seinen Armen zu knabbern. Thole lässt sie. Vertraut und freundlich wirkt der 36-jährige im Umgang mit seiner Herde, aber wie Haustiere will er sie nicht verhätscheln. „Das sind eben immer noch Nutztiere. Wenn der Nutzen da nicht hinter wäre, würde es die meisten hiervon gar nicht geben.“
Thole hält die Rasse Deutsch Angus, bekannt für ihr gutes Fleisch. Die Rinder sind deutlich kleiner als Milchkühe und haben oft braun-rotes Fell. Im Gegensatz zu den meisten großen konventionellen Betrieben hält Thole auch keine Bullen sondern Färsen. Das sind junge weibliche Rinder, die noch kein Kalb geboren haben. Deren Fleisch ist durch den hormonellen Unterschied zum Bullen geschmacksintensiver. Tholes Cousin ist Fleischer und schlachtet und zerlegt die Rinder. Anschließend wird das Fleisch noch am Knochen zur Trockenreifung in einem Kühlraum aufgehängt, wo es drei Wochen lang reift.
Ein großer Betrieb hätte für diesen Prozess gar nicht die Kühlkapazitäten, sagt Thole. „Wenn die täglich mehrere hundert Rinder schlachten, muss das nach maximal einer Woche wieder weg.“ Aber es ist genau dieser Reifeprozess, der dem Fleisch einen besonders intensiven, leicht nussigen Geschmack gibt.
Wertschätzung durch direkten Kundenkontakt
Die fertigen Fleischprodukte lagert Franz Thole in einem Kühlraum, den er eigens dafür in sein Wohnhaus auf dem Hof eingebaut hat. Bei Minus 19 Grad stapeln sich dort rote Kisten voll eingeschweißtem Fleisch. Für einen Moment verschwindet der Landwirt in der Kühlkammer. Dann tritt er etwas angestrengt unter dem Gewicht der Kiste in seinen Händen – aber stolz grinsend – heraus. Die Kiste ist voll mit eingeschweißten Burger-Patties: „der Franz-Burger“ – sein ganz persönliches Produkt.
Ein Paket mit zehn Burgerpatties à 200 Gramm kostet bei Thole 50€. Weil er seine Produkte größtenteils selbst verkauft, kann er sich selbst überlegen, wie viel Geld er verlangt. Das Wohl seiner Tiere ist dabei ein wichtiger Teil seiner Vermarktungsstrategie, denn in der Direktvermarktung sehen die Kunden selbst, woher das Fleisch kommt, das sie kaufen. Ihre Wertschätzung für Franz Thole und seine Art der Rindermast machen es möglich, dass er ein Geschäftsmodell fernab von hochoptimierten Abläufen und unabhängig von Subventionen betreibt. Für Thole auch eine Sache des Prinzips, schließlich sei es in anderen Berufen selbstverständlich, dass man von seinen Produkten leben kann, sagt er.
Preisschwankungen im konventionellen Markt
Für Ulrich Westrups Einkommen spielen Subventionen zurzeit auch keine große Rolle: Fünf bis sechs Prozent des Jahreseinkommens kämen dadurch zustande, der Rest ist selbst erwirtschaftet. Das war aber auch schon anders. Denn in der konventionellen Milchviehhaltung hängen diese Direktzahlungen vom Staat stark vom Milchpreis ab. Und der kann erheblich schwanken: „Wir hatten hier schon alles von 25 Cent pro Liter bis aktuell 1,50 Euro pro Liter“, sagt Westrup.
Weil der Milchpreis gerade so hoch ist, bezieht Westrup weniger Subventionen. In mageren Zeiten lag der Anteil am Einkommen aber auch schon manchmal bei 20 Prozent. Die staatliche Unterstützung kann allerdings nur zum Teil ausgleichen, dass der Milchpreis in der konventionellen Landwirtschaft enormen Schwankungen unterliegt und dass Betriebe wie Ulrich Westrups Hof – anders als Franz Thole – von diesem Preis abhängig sind. Sieben Millionen Liter Milch produziert der Betrieb pro Jahr. Bei dieser Größenordnung haben schon scheinbar kleinere Schwankungen im Milchpreis enorme Auswirkungen auf das Einkommen des Hofes.
Bio-Haltung – (k)eine Alternative
Die wirtschaftliche Unsicherheit in der konventionellen Tierhaltung ist für manche Landwirte auch ein Grund, sich eine Umstellung auf Bio-Haltung zu überlegen. Denn entgegen der Annahme, dass Bio-Landwirtschaft ein rein idealistisches Projekt sei, kann sie sich auch wirtschaftlich lohnen.
Konventionelle Haltung schließt Tierwohl nicht aus
Dementsprechend kann sich Bio-Haltung für Landwirte, denen es um einen hohen Tierwohlstandard geht, lohnen. Muss es aber nicht. Hohe Kosten in der Umstellung, mehr Regeln und Einschränkungen und eine höhere Abhängigkeit von Subventionen sind nur einige Gründe, warum eine Umstellung auf Bio für manche Landwirte nicht in Frage kommt. Auch muss das Tierwohl in der Bio-Haltung gar nicht unbedingt besser sein. Bio unterscheidet sich von der konventionellen Haltungsstufe vier vor allem dadurch, dass weniger Pestizide und Medikamente verwendet werden dürfen und den Tieren nur bestimmtes Futter zugeführt wird.
Franz Thole, der seine Kühe bereits auf der Weide hält und nur mit hofeigenem Gras füttert, würde viele Standards der Bio-Haltung erfüllen. Dennoch hat er sich gegen eine Zertifizierung entschieden: „Ich bin in einer Direktvermarktung, ich lade jeden Kunden ein, guckt euch das an, überzeugt euch selbst, bildet eure eigene Meinung. Wenn ihr das gutheißen könnt, dann macht ihr selbst quasi die Qualitätskontrolle. Da brauche ich so ein Label nicht.“ Landwirte können Tierwohl also auch ohne Bio-Label als essenziellen Teil ihres Geschäfts verstehen, auf dem letztendlich ihr wirtschaftlicher Erfolg basiert. Dass dieser wirtschaftliche Erfolg aber auch Ziel eines landwirtschaftlichen Betriebs ist, sieht Ulrich Westrup als selbstverständlich: „Ich finde es nicht verwerflich, mit Tieren Geld zu verdienen.“